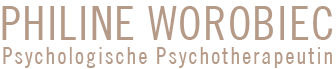12 Aug. Zur Frage der Toxizität in zwischenmenschlichen Beziehungen und wie Partnerschaft gelingen kann: Eine psychodynamische Perspektive
In meiner Praxis werde ich immer wieder gefragt: „Gibt es eigentlich toxische Beziehungen“ oder ich bekomme eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter: „Ich brauche dringend Hilfe, denn ich befinde mich in einer toxischen Beziehung“. Was hat es eigentlich mit toxischen Beziehungen auf sich und wie können wir in das Labyrinth und die Verstrickung uneindeutiger Begriffe etwas mehr Klarheit bringen. Dieser Blog Artikel soll dazu beitragen sich dem Modebegriff zu nähern.
Der Begriff „toxisch“ ist in der heutigen Alltagssprache allgegenwärtig und wird häufig verwendet, um problematische Beziehungsmuster zu beschreiben. Aus psychodynamischer Sicht lässt sich jedoch argumentieren, dass es keine „toxischen“ Beziehungen im absoluten Sinne gibt, sondern vielmehr dysfunktionale Interaktionsmuster, die ihre Wurzeln in frühen Entwicklungsprozessen haben. Diese Muster sind Ausdruck unbewusster Abwehrmechanismen und innerpsychischer Konflikte, die sich in der Interaktion zwischen den Partnern spiegeln.
Frühe Entwicklung und die Bedeutung der Mutter-Kind-Interaktion
Im Vergleich zu Tieren, die mit einer relativ hohen Instinkt- und Reflexkompetenz auf die Welt kommen, sind Menschen bei der Geburt vergleichsweise unreif und fragil. Der Säugling ist auf eine entwicklungsfördernde Umwelt angewiesen, insbesondere auf eine Bezugsperson, die in der Lage ist, seine Affekte wahrzunehmen, zu spiegeln und ihm emotionale sowie körperliche Sicherheit und Resonanz bietet. Diese frühen Interaktionen sind essenziell für die Entwicklung eines stabilen Selbstgefühls, einer gesunden Nähe vs. Distanzregulation, Emotionsregulation und erfüllende Beziehungen im weiteren Leben.
Die Forschung von Peter Fonagy und seinen Kollegen hat gezeigt, dass die Fähigkeit des Säuglings, Affekte zu erkennen und zu regulieren, maßgeblich durch die Qualität der elterlichen Spiegelung beeinflusst wird. Wenn die Mutter oder Bezugsperson selbst traumatisiert ist, unbewusst den Säugling für ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse nutzt oder keinen Zugang zu ihren Gefühlen hat, kann dies die Entwicklung eines sicheren Bindungs- und Selbstgefühls beeinträchtigen.
Bindungs- und Bewältigungsstrategien bei gestörter Entwicklung
In solchen Kontexten kann der Säugling zwei grundlegende Bewältigungsstrategien entwickeln. Die im folgenden dargestellten Bewältigungsformen wurden von dem Psychoanalytiker Michael Balint ausführlich beschrieben. Beide Formen dienen der Angstabwehr in entgegengesetzter Form (Angst vor Nähe vs. Angst vor Distanz).
1. Oknophilie (Anlehnung und Überidentifikation): Der Säugling klammert sich an die Mutter, um emotionale Sicherheit zu erlangen. Aufgrund fehlender empathischer Resonanz bleibt das Selbst jedoch unzureichend entwickelt, was zu einer Illusion der Verschmelzung führt. Diese Strategie dient dem Überleben, verhindert jedoch die Entwicklung eines autonomen Selbst. In partnerschaftlichen Beziehungen leidet dieser Typus darunter seine Autonomie im Laufe der Beziehung zu verlieren. Unbewusst ist sein Bindungssystem darauf ausgerichtet die Aufmerksamkeit beim Gegenüber zu halten statt sowohl bei sich als auch beim anderen. Die eigenen Grenzen können nicht gut vertreten werden. (Entwicklungsaufgabe: Selbstverantwortung, Autonomie trotz Beziehung).
2. Philobathie (Verleugnung und Abwehr): Alternativ kann der Säugling sich frühzeitig von der Mutter abspalten, um schmerzhafte Affekte und Nähe zu verleugnen. Diese Abwehrmechanismen, wie Narzissmus oder schizoide Abwehr, führen dazu, dass Nähe- und Abhängigkeitsbedürfnisse verdrängt werden, was sich in späteren dysfunktionalen Beziehungsmustern manifestieren kann. In partnerschaftlichen Beziehungen leidet dieser Typus darunter Nähe, Emphatie und Abhängigkeit zu zulassen. In der Beziehung wird immer wieder die Bedeutung der eigenen Autonomie im handeln unbewusst zum Ausdruck gebracht. Der Partner bekommt zu wenig emotionale Bedeutung. (Entwicklungsaufgabe: Hingabe, zulassen von Nähe und Abhängigkeit, Abhängigkeit in Beziehung lernen).
Dysfunktionale Beziehungsmuster und die Rollen der Bewältigungsstrategien
In Partnerschaften spiegeln sich häufig zwei unterschiedliche Bewältigungsstile wider: Der „oknophile“ Typus, der Schwierigkeiten hat, Grenzen zu setzen und Autonomie innerhalb der Partnerschaft zu entwickeln, sowie der „philobate“ Charakter, der nicht in der Lage ist, Verletzlichkeit und emotionale Bezogenheit zuzulassen. Während der oknophile Partner lernen muss, sich abzugrenzen und die eigene Autonomie zu stärken, wird dem philobaten Partner vermittelt, dass das Zulassen von Verletzlichkeit und Abhängigkeit eine Reifungschance darstellt.
Diese Dynamik ist nicht geschlechtsspezifisch, sondern beschreibt vielmehr unterschiedliche Bewältigungsstrategien in früh erworbenen dysfunktionalen Beziehungskontexten.
Das Selbst strebt nach ganzheitlicher Integration und innerer Harmonie. Nach C.G. Jung trägt jeder Mensch in sich das unvergängliche Bild eines Kindes – ein ewiges Kind, das sich auf dem Weg der Selbstentwicklung befindet. Dieses innere Kind symbolisiert den Teil unserer Persönlichkeit, der nach Vollendung und innerer Einheit strebt. Jede Partnerschaft kann daher als ein Spiegel der noch unvollständig integrierten Anteile verstanden werden. Sie bietet die Möglichkeit, verborgene Aspekte unseres Selbst zu erkennen und zu heilen.
Eine erfüllte Beziehung basiert nicht nur auf Empathie und gegenseitigem Verstehen, sondern auch auf der bewussten Auseinandersetzung mit unserer eigenen Abhängigkeit und den damit verbundenen Mustern. Die Fähigkeit, früh erworbene Bewältigungsstrategien zu erkennen und in der Gegenwart neu zu gestalten, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu innerer Freiheit und spirituellem Wachstum. Wer sich weigert, Verletzlichkeit zuzulassen und eigene Abhängigkeiten anzuerkennen, kann unbewusst Kontrolle und Macht über den Partner ausüben, was die Balance zwischen Nähe und Distanz gefährdet. Das bewusste Wahrnehmen dieser Dynamiken ist essenziell, um Opfer- und Täterrollen zu vermeiden und eine authentische, liebevolle partnerschaftliche Verbindung zu fördern.
Beziehungen sind vielschichtige und komplexe Prozesse, die uns auf unserem Weg der Selbstentdeckung begleiten. Die Integration unbewusster Gefühle und innerer Anteile kann durch eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie wertvolle Unterstützung bieten, um das eigene Werden zu verstehen und zu fördern.
Im spirituellen Sinne ist jede Begegnung eine Chance, das eigene Selbst zu vertiefen, alte Wunden und die damit einhergehenden Gefühle zu heilen und das Leben in seiner Ganzheit zu umarmen. Durch bewusstes fühlen und liebevoller Akzeptanz können wir unsere inneren Anteile integrieren und so zu einem Zustand innerer Balance und spiritueller Reife gelangen.
Hier einige Fragen, die den oknophilen Charakter (übermäßig abhängig, Angst vor der eigenen Autonomie) auf seinem Weg der Selbstentfaltung begleiten können:
-
Was spiegelt mir meine PartnerIn über meine inneren Anteile wider?
-
Wann in meinem Leben wurde ich in meiner Selbstwirksamkeit und Autonomie unzureichend emotional begleitet?
-
Wo gebe ich möglicherweise meine Selbstverantwortung und Selbstermächtigung unbewusst in die Hände meines Partners und was vermeide ich dadurch zu fühlen?
-
Welche Gefühle weigere ich mich, zuzulassen?
-
Welche Gefühle entstehen in mir, wenn ich in der Beziehung Distanz aushalte?
-
Welche kindlichen Sehnsüchte projiziere ich auf meinen Partner?
-
Was will ich wirklich in meinem Leben? Was bereitet mir Freude?
-
Wann in meinem Leben war es nicht möglich mir selbst emotional nah zu sein, weil ich damit beschäftigt war „andere zu retten“?
-
Wann in meinem Leben war ich alleine und wie geht es mir heute mit dem alleine sein?
-
An welchen Orten und mit welchen Menschen kann ich ganz ich selbst sein?
Hier einige Fragen, die den philobaten (übermäßig autonom, Angst vor Nähe und Bindung) Charakter auf seinem Weg zur Selbstentfaltung begleiten können:
-
Was löst Hingabe in mir aus?
-
Was geschieht in mir, wenn ich Abhängigkeitsgefühle annehme und zulasse?
-
Was spiegelt mir mein Gegenüber über meine inneren Bedürfnisse?
-
Welche Gefühle weigere ich noch immer zu fühlen?
-
Was fühle ich, wenn ich in meinem Herzen Zuflucht suche?
-
Wie steht es um die Beziehung zu mir selbst?
Literaturempfehlungen zum Blog Artikel:
Fonagy, P., Gergely, G., Target, M., & Bateman, A. (2002). The development of the capacity for mentalization. In P. Fonagy & G. Gergely (Eds.), Mentalization (pp. 25–48). London: Routledge.
Fonagy, P., Bateman, A., & Gergely, G. (2015). Mentalization-based treatment for borderline personality disorder. New York: The Guilford Press.
Kohut, H. (1971). The analysis of the self. New York: International Universities Press.
Jung, C. G. (1932). Antworten auf Fragen der Psychologie. In Gesammelte Werke (Vol. 18, pp. 123–145). Zürich: Rascher.
Jung, C. G. (1959). Die Archetypen und das kollektive Unbewusste. In Gesammelte Werke (Vol. 9, Part 1, pp. 3–576). Zürich: Rascher.